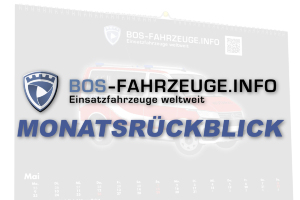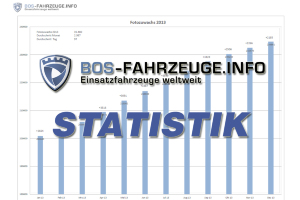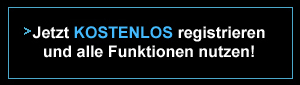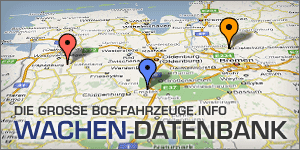Hans-Christian Seebohm wurde 1903 in Kattowitz (Schlesien, heute Polen) geboren. Als Bergbauingenieur arbeitete er bis 1945 in der Kohleindustrie in leitenden Positionen, nach Kriegsende in der Erdölindustrie. 1947 war er Gründungsmitglied der sehr stark rechtsgerichteten Deutschen Partei (DP), deren Vorsitzender er zeitweilig war. In den späten 1950er Jahren entfernte er sich allmählich innerlich von der DP und wechselte deshalb 1960 in die CDU. Von 1949 bis zu seinem Tod 1967 war er Bundestagsabgeordneter. Am 20. September 1949 wurde er als Verkehrsminister in die erste Bundesregierung unter Bundeskanzler Adenauer berufen. Dieses Amt hatte er bis 1966 inne, die letzten vier Jahre mit Ludwig Erhard als Kanzler.
Auf europäischer Ebene hatte eine Tagung der Verkehrsminister in Genf im August/September 1949 ein Abkommen getroffen, dass einheitliche Regelungen vorsah und der Nutzfahrzeugindustrie Rechtssicherheit geben sollte. Neben den noch heute gültigen Größtmaßen von 2,50 m Fahrzeugbreite und 4 m Höhe wurden 18 m Lastzughöchstlänge und 32 t Höchstgewicht festgelegt. Deutschland hatte dieses Abkommen nicht mitunterschrieben, da einerseits die neue Bundesregierung noch gar nicht im Amt war und andererseits ohnehin die Zustimmung der Alliierten notwendig gewesen wäre. Schließlich war Deutschland auch nach dem Regierungsantritt von Adenauer kein souveräner Staat.
Im Sommer 1940 war von der damaligen nationalsozialistischen Regierung – wegen kriegswichtiger Transporte – das Mitführen zweier auflaufgebremster Anhänger hinter einem LKW gestattet worden. Das wurde durch Seebohm ab 1. April 1953 aus Sicherheitsgründen wieder verboten, lediglich bei Zugmaschinen ist es bis heute erlaubt. Die (deutsche) Lastzuglänge durfte nun statt 22 m maximal 20 m betragen, bei Sattelzügen nur 14 m. Gleichzeitig waren weiterhin 40 t zul. Gesamtgewicht und 10 t Achslast gestattet – die beide in der Praxis häufig genug drastisch überschritten wurden.
Die Neuregelung brachte den Spediteuren bereits erste Probleme, im Grunde waren die Bestimmungen aber noch nachzuvollziehen. Vorbei waren die Zeiten, in denen endlos lange Lastzüge sich im 1. Gang langsamer als mit Schrittgeschwindigkeit die Kasseler Berge hochquälten. Versagte auch dazu die Kraft, wurde der hintere Anhänger abgekuppelt und am Rand stehen gelassen, der vordere Anhänger den Berg hochgezogen, ebenfalls abgekuppelt, dann der zweite Anhänger nachgeholt. Am nächsten Berg wiederholte sich das Spiel. Das sind heute unvorstellbare Zustände.
Bereits Mitte der 1950er Jahre zeigte sich, dass vor allem die Deutsche Bundesbahn, aber auch die vielen lokalen Bahngesellschaften der Konkurrenz durch den LKW-Verkehr nicht standhalten konnten. Derartige Befürchtungen hatte es bereits in den 1920er und 1930er Jahren gegeben. Die Nationalsozialisten hatten dann ab 1933 zur Kriegsvorbereitung ganz klar das Auto bevorzugt, die damalige Deutsche Reichsbahn war aber wegen der allgemeinen Aufrüstung trotzdem noch auf ihre Kosten gekommen.
Nach Kriegsende war das Bahnnetz jedoch zunächst so stark zerstört gewesen, dass der Schienenverkehr massiv Transportraum und Tonnage an die flexibleren LKW verloren hatte. Um der Bundesbahn wieder in die Profitzone zu verhelfen, wurde im Bundesverkehrsministerium unter Seebohm eine „Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Straßenverkehrsordnung“ ausgearbeitet, die am 21. März 1956 erlassen wurde. Für Neufahrzeuge trat sie zum 1. Januar 1958 in Kraft, für bis dahin bereits zugelassene LKW gab es Übergangsfristen bis zum 1. Juli 1960.
Festgelegt wurde, dass zweiachsige LKW maximal 11Meter lang sein und ein zulässiges Gesamtgewicht von 12 t nicht überschreiten durften. Für Dreiachser galten 12 m und 16 t, Lastzüge durften höchstens 24 t schwer sein. Besonders gravierend war die Kürzung der Lastzuglänge auf 14 m, also auf Sattelzugniveau. Weitere Einschränkungen waren eine Achslast von 8 t und eine Mindestmotorleistung von 6 PS pro Tonne.
Die Spediteure liefen Sturm gegen diese Neuregelungen, genauso der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Verband der Automobilindustrie. Einige Nachbarstaaten unternahmen diplomatische Schritte, weil sie befürchteten, dass ihre längeren Lastzüge in absehbarer Zeit nicht mehr in die Bundesrepublik fahren dürften. Seebohm und mit ihm die Regierung Adenauer zeigten sich jedoch stur, und auch die Opposition im deutschen Bundestag wollte der Bundesbahn den Rücken stärken.
Für die Daimler-Benz AG bedeuteten die Seebohmschen Gesetze das Aus für ihre Schwerlastbaureihen L 315 und L 325 in Deutschland. Beide waren unter den neuen Bedingungen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Firma stand jetzt – genau wie ihre Mitbewerber – vor dem Problem, einerseits den deutschen Vorschriften entsprechende LKW bauen zu müssen, andererseits aber die wichtigen Exportmärkte nicht zu vernachlässigen, die ganz andere Anforderungen stellten. Es begann eine Zeit der Zweigleisigkeit in der LKW-Produktion. Für den deutschen Markt entstanden vor allem Frontlenker aus der Pullman-Reihe, die hier nicht betrachtet werden sollen.
Mercedes-Benz L 326
Noch während der Produktionszeit des Mercedes-Benz L 315 war im November 1956 sein „Nachfolger“ für den Exportmarkt, der L 326, in Serie gegangen. Ab Frühjahr 1957 konnte er auch von deutschen Kunden erworben werden. Äußerlich unterschied er sich überhaupt nicht vom anschließend nicht mehr hergestellten L 315. Neu war hingegen der Motor OM 326. Die höhere Leistung von 192 bis 200 PS bei 2.200 U/min hatte man durch eine Vergrößerung des Hubraums auf 10.810 cm³ erreicht. Die Fahrgestellvarianten waren weitgehend die gleichen wie zuvor beim L 315, also Radstände von 5.200 mm und 4.600 mm, dazu 3.600 mm für Kipper und Sattelzugmaschinen. Daneben gab es wieder eine Kommunalausführung, aber (offiziell) keine Allradversion! Dennoch können weiter unten einige Allradfahrzeuge vorgestellt werden. Offenbar wurde dabei einfach auf Komponenten zurückgegriffen, die noch vom LA 315 vorhanden waren.
Für den Inlandsmarkt durfte das zulässige Gesamtgewicht vorläufig noch 15 t betragen, im Export sogar 17,5 t. Mit 192 PS durfte der Zug (bei 6 PS /t) ein zul. Gesamtgewicht von 32 t haben, das entsprach den europäischen Vorgaben. Problematischer waren das (ab 1958 in Deutschland un-) zulässige Gesamtgewicht und die mögliche Zuglänge, hier störte einfach die lange Motorhaube. Daher wurde die Produktion bereits 1958 nach nur 313 gebauten Exemplaren wieder eingestellt. Wirtschaftlich muss das für die Daimler-Benz AG ein Fiasko gewesen sein. Damit endete gleichzeitig die Ära der schweren Langhauber, bei denen die Scheinwerfer auf den Kotflügeln montiert waren. Die wesentlich älter wirkenden Fahrzeugbaureihen mit Lampen auf der Stoßstange dagegen wurden weiter gebaut, wie unten gezeigt wird.
Verglichen mit der geringen Gesamtzahl sind erstaunlich viele Feuerwehrfahrzeuge auf diesem Fahrgestell gebaut worden, natürlich alle von Metz. Die Flughäfen Köln-Bonn und Stuttgart erhielten 1957 je ein Zubringerlöschfahrzeug mit einer FP 25/8, 4800 l Wasser und 480 l Schaummittel. Von Metz wurden sie als „FLF 25 W“ bezeichnet. Ob es sich wirklich um Mercedes-Benz LA 326/46 handelte oder (vielleicht auch nur beim Kölner Fahrzeug) noch um LAKo 315/46, ließ sich nicht zweifelsfrei klären. Die Angaben in der Literatur sind sehr verworren und widersprechen sich zum Teil erheblich, auch grundsätzlich falsche Daten werden genannt. Äußerlich ist wie gesagt zwischen den Baureihen L 315 und L 326 kein Unterschied festzustellen.

FLF 25 W, Mercedes-Benz LA 326/46 (?), Metz, Baujahr 1957, geliefert als Zubringerlöschfahrzeug an die Werkfeuerwehr des Flughafens Stuttgart. Später wurde das Fahrzeug an die WF MBB in Kirchheim-Nabern abgegeben, danach kam es in Sammlerhände. Ein herzlicher Dank an Bernd Kirstein (Mainz) für das Foto.
Als einzige deutsche Feuerwehr erhielt die BF Saarbrücken 1957 eine DL 37 auf dem Mercedes-Benz LKo 326/52.
Die BF Hannover beschaffte im selben Jahr gleich zwei Mercedes-Benz LAKo 326/52, nämlich als GW 3 und als KW 12. Hier ging man also konsequent den Weg einer Trennung von Kranfahrzeug und Rüstwagen. Mindestens der Kran ist bis heute im Hannoverschen Straßenbahn-Museum erhalten geblieben und gelegentlich auf Oldtimertreffen zu sehen.

KW 12, Mercedes-Benz LAKo 326/52, Metz, Baujahr 1957, ursprünglich eingesetzt durch die BF Hannover, seit Jahrzehnten bereits Museumfahrzeug, untergestellt im Hannoverschen Straßenbahn-Museum. Das Vorderachsdifferential, dass den Kran eindeutig als Allradfahrzeug ausweist, ist nicht zu übersehen.
Von Werkfotos her bekannt ist ein von Metz gebauter Rüstkranwagen RKW 10 , der ebenfalls auf dem Mercedes-Benz LAKo 326/52 geliefert wurde. Der Empfänger waren die Saab-Flugzeugwerke in Linköping (Schweden). Interessanter Weise wurde zusätzlich eine Pulverlöschanlage mit 750 kg Pulver eingebaut.
Mercedes-Benz L 329
Zur Ablösung des Sechstonners L 325 wurde schon 1956 die Baureihe L 329 vorgestellt. Sie war eine Mischung aus zwei bereits bekannten Typen. Stoßstange und Motorhaube stammten vom L 325, das Führerhaus und vor allem der Motor aber vom L 315. Dessen Namensgeber, der Sechszylinder-Dieselmotor OM 315, leistete hier wieder 145 PS bei 2.100 U/min, die er aus 8.276 cm³ Hubraum holte. Auch Getriebe und Hinterachse entsprachen dem schwereren L 315.
Weil das Führerhaus vom 315 abstammte, ließ sich der neue L 329 leicht vom älteren L 325 unterscheiden: Die Türen besaßen jetzt ein angeschweißtes Blech, das bis zur untersten Trittstufe reichte. Beim L 325 war hier ein deutliches „Loch“ gewesen. Die Nutzlast des L 329 lag bei 6,5 t, und das bei nur 5,5 t Eigengewicht. Damit befand er sich als zweiachsiger Solowagen im Bereich der Seebohmschen Vorschriften und war (mit 3.600 mm Radstand) auch als Sattelschlepper nutzbar. Angeboten wurden ansonsten Radstände von 4.200 mm und 4.600 mm.
1957 kam für diese Baureihe erstmals nach dem Krieg wieder eine Allradversion auf den Markt, mit 4.200 mm Achsabstand für den Kipper LAK 329 und 3.600 mm für die Allrad-Sattelzugmaschine LAS 329.
Anfang 1958 wurde die Produktion der Baureihe L 315 eingestellt und damit gleichzeitig auch die Fertigung des Motors OM 315. Was bei deren äußerlich unverändertem Nachfolger L 326 gepasst hatte, musste auch beim L 329 passen, nämlich der Motor OM 326 mit 10,6 Litern Hubraum, Er wurde ab 1958 als OM 326 IV auch in diese Baureihe eingebaut, allerdings mit der verminderten Leistung von 172 statt 192 bis 200 PS.
Die Produktion des L 329 mit Hinterachsantrieb endet bereits 1959, nur die Allradversion wurde noch bis 1962 vor allem für den Export gebaut. Am Ende waren 910 Straßenfahrgestelle und 1024 Allradchassis hergestellt worden.
Die einzige mechanische Drehleiter auf dem Mercedes-Benz LKo 329/46 war eine DL 30 von Metz, die 1958 an die BF Hagen geliefert wurde. Möglicherweise ist sie sogar das einzige Feuerwehrfahrzeug, das überhaupt auf diesem Fahrgestell produziert wurde. Nach ihrer Dienstzeit bei der BF Hagen wurde sie Mitte der 1970er Jahre von einem Malerbetrieb übernommen, danach verliert sich die Spur. Ein Foto können wir leider nicht zeigen.
Mercedes-Benz L 330
Als weiteres Exportmodell wurde ab Juni 1957 der Mercedes-Benz L 330 mit dem Sechszylinder-Dieselmotor OM 315.II produziert. Er leistete 125 PS bei 2.000 U/min und damit 20 PS weniger als der ansonsten baugleiche „normale“ OM 315. Hier von einer Weiterentwicklung des Motors zu sprechen, ist nicht unbedingt angebracht. Für den Export galten ganz einfach andere Anforderungen. Das zulässige Gesamtgewicht lag bei 12 bis 13 Tonnen, eine Allradversion war nicht vorgesehen. Bis 1961 wurden 1854 Fahrzeuge produziert.
Auch hier ist wieder nur ein einziges deutsches Feuerwehrfahrzeug bekannt geworden, das darüber hinaus auch noch „selbst gestrickt“ wurde. Einen 12.000 Liter-Tankauflieger der Firma Eylert von 1950 sattelte die BF Offenbach auf einen Mercedes-Benz LS 330/36 des Baujahrs 1959 auf. Genutzt wurde das Gespann, von dem Jürgen Mischur uns ein Regenfoto zur Verfügung stellte, bis zum Beginn der 1980er Jahre.

Sattelzugmaschine, Mercedes-Benz LS 330, Baujahr 1959, mit Tankauflieger12.000 l der Fa. Eylert von 1950. Das Gespann wurde von der BF Offenbach sowohl für den Wassertransport als auch zur Aufnahme auslaufender Flüssigkeiten genutzt.
Mercedes-Benz L 331
Ebenfalls 1957 verließen die ersten Exemplare des L 331 die Produktionshallen in Mannheim. Das für den Export konzipierte Fahrgestell gab es auch in der Allradversion als LA, LAK und LAS, also Pritschenwagen, Kipper und Sattelzugmaschine. Im Motorraum werkelt zunächst der OM 326.II, dessen 150 PS bei 2.000 U/min nur 75% der Leistung des „richtigen“ OM 326 lieferten. Ab 1958 wurde mit dem OM 326/IV die Leistung auf 172 PS bei 2.200 U/min erhöht. 1959 wurde die Produktion eingestellt, nachdem 309 Straßen- und nur 72 Allradfahrzeuge auf die Räder gestellt worden waren.
Zu diesen Allradfahrgestellen gehörte auch eine Kleinserie von mindestens drei FLF 30 mit CO2-Löschanlage, die Metz im Juli 1958 nach Karachi, der damaligen Hauptstadt Pakistans, liefert. Staffelkabine mit daran anschließendem Geräteraum für die CO2-Anlage, großer Wassertank mit seitlich angebrachten Saugschläuchen, Schaummitteltanks auf den Trittbrettern und ein Dachwerfer mit Schwerschaumrohr gehörten zu den Merkmalen dieser imposanten Fahrzeuge.
Die Feuerwehr Sao Paulo (Brasilien) beschaffte im gleichen Jahr ein SLF 30 in „amerikanischer Bauart“ mit Truppführerhaus, Mittelpumpe und Schlauchbetten über dem Wassertank. Am Heck stand der Rest der Besatzung auf dem Trittbrett.
Die seinerzeit größte deutsche Drehleiter erhielt die BF der „Metz-Stadt“ Karlsruhe im Jahre 1960. Auf ein Fahrgestell vom Typ Mercedes-Benz LKo 331/52 setzte Metz den ersten hydraulisch angetriebenen Leiterpark einer DL 37 mit fünfteiligem Leiterpark. Bis 1980 blieb die Drehleiter in Karlsruhe im Einsatz, dann wurde sie an die FF Marktheidenfeld (Main-Spessart-Kreis) verkauft, wo sie bis 1988 genutzt wurde.

DL 37h, Mercedes-Benz LKo 331/52, Metz, Baujahr 1960, geliefert an die BF Karlsruhe. 1980 wurde die Drehleiter an die FF Marktheidenfeld verkauft und weitere acht Jahre genutzt. Während dieser Zeit entstand das Foto von Klaus Fischer.
Die BF Fürth beschaffte für ihren Rüstzug bei Metz einen KW 10 auf Mercedes-Benz LA 331/46. Als Baujahr war 1959 in der Tür eingeschlagen, die Erstzulassung erfolgte jedoch erst im Januar 1960. Seit vielen Jahren bereits ist das Fahrzeug in Sammlerhand.

KW 10, Mercedes-Benz LA 331/46, Baujahr 1959, im Januar 1960 von der BF Fürth in Dienst gestellt und bis in die 1980er Jahre genutzt, heute museal erhalten. Siehe auch Titelbild.
Mindestens ein weiterer KW 10 auf dem gleichen Fahrgestell wurde 1961 an einen momentan nicht bekannten südamerikanischen Kunden geliefert
Mercedes-Benz L 332
Den Mercedes-Benz L 332 gab es von 1958 bis 1962 zu kaufen, mit 150 PS aus dem OM 326.II war er als Langhauber wieder ein reines Exportfahrzeug. 2787 Fahrgestelle mit Hinterachsantrieb und 480 Allradfahrzeuge wurden produziert. Äußerlich sind sie von den Baureihen Mercedes- Benz L 329 bis L 331 nicht zu unterscheiden
In den Export nach Jugoslawien ging mindestens ein FLF 30 mit zusätzlicher CO2-Löschanlage auf Mercedes-Benz LAKo 332/46. An die Berufsfeuerwehr Ankara lieferte Metz 1962 eine DL 44 auf dem L 332/52. Der Leiterpark des rund 18 t schweren Fahrzeug bestand aus sechs Segmenten.
Einziges in Deutschland in Dienst gestelltes Fahrzeug auf Mercedes-Benz LA 332/52 war der RKW 10 der BF Bielefeld. Es war gleichzeitig der letzte von einer deutschen Feuerwehr fabrikneu beschaffte Langhauber. Bis zum Ende der 1980er Jahre blieb der wuchtige Rüstkranwagen im Dienst, dann erwarb ihn ein Darmstädter Oldtimersammler.

RKW 10, Mercedes-Benz LA 332/52, Metz, Baujahr 1962, über 25 Jahre lang im Dienst bei der BF Bielefeld, heute von einem Sammler erhalten.
Mercedes-Benz L 334
Von der Logik her hätte jetzt der Mercedes-Benz L 333 an die Reihe kommen müssen, den produzierte die Daimler-Benz AG von 1958 bis 1961 aber nur als Frontlenker. Der LP 333 mit zwei gelenkten Vorderachsen und 16 t zulässigem Gesamtgewicht war eine Reaktion auf Seebohms Bestimmungen und verkaufte sich recht gut. Für den Export gab es ihn auch mit bis zu 22,5 t zul. Gesamtgewicht, aber eben nicht als Hauber.
Letztes Langhaubermodell war darum der Mercedes-Benz L 334, ebenfalls von 1958 bis 1962 im Verkaufsprogramm. Er wurde wieder vor allem fürs Ausland hergestellt, war aber auch als LK 334 auf deutschen Baustellen im Einsatz. Als Motor wurde der bereits bekannte OM 326 mit 10.810 cm³ Hubraum und 192 bis 200 PS bei 2.200 U/min verwendet. Trotz des gänzlich anderen Aussehens (Scheinwerfer auf der Stoßstange und nicht auf dem Kotflügel) war der L 334 sozusagen die schwerere Fortsetzung des L 326, denn statt 16 t zul. Gesamtgewicht beim L 326 waren jetzt (im Ausland) bis zu 19 t möglich. Gleichzeitig war die Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 77 km/h gestiegen. Von diesem nur in der Straßenversion aufgelegten Modell wurden 1207 Exemplare verkauft.
Wieder gelangte nur ein einziges Exemplar dieser Baureihe zu einer deutschen Feuerwehr. Die WF Hoechst in Frankfurt a.M. nahm 1961 einen damals noch als Wechselaufbaufahrzeug (WAF) bezeichneten Mercedes-Benz LK 334/42 in ihren Fuhrpark auf. Das Fahrgestell soll etwas älter und aus dem Werksfuhrpark gewesen sein, die Meiller-Wechseleinrichtung wurde 1961 aufgesetzt. Etwa 20 Jahre lang wurde dieses Einzelstück genutzt, Fotos davon sind sehr rar. Umso erfreulicher ist, dass wir zumindest ein Foto von Jürgen Mischur zeigen können, welches er vor etwa 40 Jahren im Schneetreiben aufnehmen konnte.

WLF, Mercedes-Benz LK 334/42, Baujahr verm. 1958, Aufbau durch Meiller 1961 aufgesetzt, WF Hoechst, Frankfurt am Main.
Noch einmal zurück zu Verkehrsminister Seebohm und seinen Beschränkungen für den Güterverkehr. Seine Erwartung, dass die von ihm vorgeschlagenen Maße und Gewichte zur Grundlage einer europäischen Regelung würden, erfüllte sich nicht. Die Nachbarstaaten beharrten auf den Bestimmungen der oben genannten Genfer Konvention von 1949. Gleichzeitig blockierte auch die Automobilindustrie die Entwicklung weiterer Typen, die seinen Vorstellungen entsprachen. Seebohm geriet zunehmend unter Druck.
Seit 1957 war Deutschland EWG-Mitglied, und Fachausschüsse dieser Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft legten Anfang 1960 den Entwurf für eine neue internationale Übereinkunft vor. Vorgeschlagen wurde dort eine Lastzuglänge von 18 m und 32 t Höchstgewicht – also keine Veränderungen gegenüber dem Stand von 1949! Neu war lediglich die zulässige Belastung von 10 t auf der Antriebsachse.
Den Gewichtsänderungen stimmte Seebohm zu, gestattete aber nur 15,5 m Lastzuglänge. Jetzt stellte sich die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag (der er durch seinen Wechsel von der Deutschen Partei gerade beigetreten war) gegen ihn und forderte mehr Zugeständnisse, um das internationale Abkommen zu verwirklichen. Die Presse sprach vom „Zentimeterkrieg“.
Seebohm begann zu feilschen, er bot 16 m Lastzuglänge an. Würde das Bundeskabinett (also die gesamte Bundesregierung) auf 18 m Länge bestehen, wollte er zurücktreten. Bei internationalen Verhandlungen bot er wenig später plötzlich 16,5 m an, eine Einigung blieb jedoch zunächst aus. Man wollte jetzt „bis 1965 versuchen, eine endgültige Regelung zu finden“ – für die Nutzfahrzeugindustrie und die Spediteure ein unhaltbarer Zustand.
Tatsächlich gelang es dann doch noch, sich zu einigen. Es blieb im Wesentlichen bei den Kompromissvorschlägen, im Einzelnen galten ab sofort 11 m Länge und 16 t zul. Gesamtgewicht für Zweiachs-LKW, 12 m Länge und 22 t Gesamtgewicht für Dreiachs-LKW, 15 m Gesamtlänge für Sattelzüge, 16,5 m für Lastzüge. Beide Züge durften maximal 32 t auf die Waage bringen.
Im Rückblick kann man die Seebohmschen Bestimmungen als die größte Einschränkung der deutschen Nutzfahrzeugproduktion in der Nachkriegszeit betrachten. Für Hersteller und Spediteure war sie zunächst eine wirtschaftliche Katastrophe. Andererseits führten die Beschränkungen aber auch zur Entwicklung moderner, leistungsfähiger Lastkraftwagen, ließen die letzten abgewirtschafteten Kriegsfahrzeuge aus dem Fernverkehr verschwinden und verhalfen den Kurzhaubern und Frontlenkern zum Siegeszug. Das darf man bei aller Kritik an Seebohms Politik nicht vergessen.
Mit dieser 30. Folge der Artikelserie endet die Darstellung der Langhauberfahrzeuge von Mercedes-Benz. Das ist Anlass genug, einmal ausdrücklich den Bildautoren zu danken, ohne deren Fotografien eine solche Reihe nicht möglich gewesen wäre.
Wer erwartet hat, dass jetzt die Kurzhauber aus dem Hause Daimler-Benz an der Reihe wären, den müssen wir leider enttäuschen. Das hat zwei Gründe: Zum einen würden wir uns dann bereits in den 1960er Jahren und damit deutlich in der Wirtschaftswunderzeit befinden. Die letzten Kurzhauber sind auch erst nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in den 1990er Jahren ausgeliefert worden und vielfach noch im Einsatzdienst. Das ist uns ganz einfach zu modern.
Der andere Grund ist die unübersehbare Fülle an Fahrzeugvarianten und -bildern aus dieser Zeit. Nach vorsichtigen Schätzungen wären wir – bei weiterhin vierwöchigem Rhythmus – vier bis fünf Jahre mit Artikeln über diese Baureihen beschäftigt.
Wir wollen hier aber eben nicht nur über Mercedes-Benz-LKW berichten. Daher werden wir uns in den nächsten Folgen einigen weniger verbreiteten Herstellern der Nachkriegszeit zuwenden. Den Anfang wird die Firma Krupp machen, die nach 1945 zunächst unter dem Namen Südwerke produzierte.
Wir hoffen weiterhin auf Ihr und Euer Interesse und bitten ausdrücklich um Rückmeldungen, Ergänzungen und Kritik.
(wird fortgesetzt)
Text: Klausmartin Friedrich
Bilder: Frank Brinkmann, Klaus Fischer, Klausmartin Friedrich, Bernd Kirstein, Jürgen Mischur, Sammlung Tim Raml
Literatur (u.a.):
Oswald, Werner: Mercedes-Benz – Lastwagen und Omnibusse 1896-1986. Stuttgart 2008.
Regenberg, Bernd: Die deutschen Lastwagen der Wirtschaftswunderzeit, Band 2 Mittlere und schwere Fahrzeuge. Brilon, 1986.
Die Zeit (Hrsg.): Minister Seebohm antwortet nicht. Die Zeit Nr. 43/1961 vom 20.10.1961